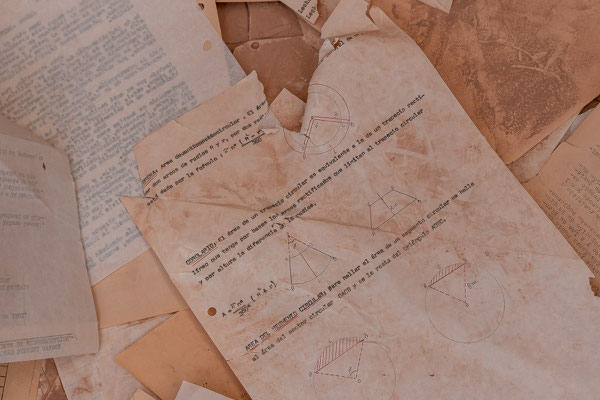Chile - Verlassene Orte der Atacama
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde beinahe der gesamte Weltbedarf an Salpeter in der Atacama-Wüste im Norden Chiles gefördert. Salpeter wurde in den Industrieländern aufgrund seines Stickstoffgehaltes als Düngemittel stark nachgefragt, um die wachsenden Bevölkerungen ernähren zu können, und diente außerdem der Herstellung von Sprengstoff. Entsprechend lukrativ war der Abbau. Salpeter machte bis zu 80 % des gesamten chilenischen Exportes aus; das ganze Land lebte von diesem weißen Gold, wie es damals auch genannt wurde. Tausende Menschen zogen in die trockenste Wüste der Erde, um in den Oficinas Salitreras, den Salpeterwerken, zu arbeiten.
Im Ersten Weltkrieg wurde Deutschland durch die britische Seeblockade vom Salpeterimport aus Chile abgeschnitten. Fritz Haber und Carl Bosch gelang in dieser Zeit die Synthese von Ammoniak aus dem Stickstoff der Luft im großtechnischen Maßstab, was Deutschland vom Salpeterhandel unabhängig machte. Nach dem Ende des Kriegs führte die Verbreitung dieses als Haber-Bosch-Verfahren bekannt gewordenen Prozesses zum schrittweisen Niedergang des Handels mit Salpeter aus Chile. Die Produktion brach ein und die Salpetergewinnung bot immer weniger Menschen Arbeit. Die einst mehr als 170 über die Atacama verteilten Salpeterwerke wurden nach und nach aufgegeben.
Übrig blieben Geisterstädte und Geisterfabriken, die sich in der Pampa Salitrera, der Salpeterwüste, über hunderte Kilometer aufreihen. Häufig sind nur noch Reste von Grundmauern und Schutt vorhanden. Ebenso finden sich immer wieder Geisterfriedhöfe, die mit ihren von der Sonne ausgebleichten Holzkreuzen in der umgebenden marsartigen Landschaft auf eigentümliche Weise gespenstisch wirken und oft die letzten Überbleibsel der ehemaligen Wüstensiedlungen sind.
Die verlassenen Orte der Atacama sind einmal mehr Zeuge dafür, wie der Mensch zum Zwecke der Ausbeutung von Bodenschätzen selbst in die lebensfeindlichsten Umgebungen vordringt und härtesten Bedingungen trotzt, sei es hier in der trockensten Wüste der Erde oder, wie das Beispiel Pyramiden zeigt, in der Nähe des Nordpols, bei niedrigsten Temperaturen und mit mehreren Monaten Polarnacht.